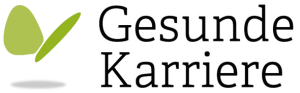Unsere gegenwärtige Sinnwelten werden nicht so weitergehen. Alles ist
endlich. Und was wir bis zum Maximum der eigenen Fähigkeiten beherrschen, wird früher oder später langweilig, banal oder gedankenlos und damit gefährlich. Aufhören sichert das Erreichte. Weitermachen würde es banalisieren.
Mit diesem Blogbeitrag möchte ich die Kunst des Aufhörens aus der Versenkung holen. Denn wir meinen: Aufhören können ist eine hoch unterschätzte Kompetenz. In diesem Blog reflektiere ich dazu, was genau Aufhören bedeuten kann, wieso es uns so schwerfällt und welche Kompetenzen uns darin unterstützen können, besser zu werden.
Wandeldynamiken
Wir reflektieren Veränderungen gerne mit der Wandel-Triade von Kornelia Rappe-Giesecke. Die Triade besagt, dass Wandel die Emergenz aus Bewahren, Optimieren und Innovieren ist.
Bewahren bedeutet, das Bisherige zu würdigen. Was war wichtig für das, was bisher unsere Realität war? Es bedeutet auch: entscheiden, was so gut war, dass es für zukünftige Herausforderungen bestehen soll. Manchmal bedeutet Bewahren auch, an Gewohnheitswirklichkeiten festzuhalten und (zu viel?) Veränderungsenergie zu binden.
Optimieren heißt: das, was da ist, anpassen an neue Begebenheiten. Es ist ein Qualitätsversprechen. Manchmal ist Optimieren leider nur die richtige Antwort auf falsche Fragen. Unsere Weltenlage (Globalisierung, Klimakrise, Artensterben, Corona-Pandemie) macht deutlich: Besser machen kann in Endlichkeit auch keine alleinige Lösung sein.
Der dritte Aspekt von Wandel ist Innovation. Das ist das Neue. Wir erfinden und kreieren. Manchmal zum Selbstzweck. Neu scheint manchen per se besser als bisheriges. Zum anderen geht es in der Innovation um Zerstörung des Alten, ums Weglassen von zukünftig schädlichem Verhalten. Die Nachhaltigkeitsforschung nennt das Exnovation. Das ist das Aufhören. In einer begrenzten Welt ist Aufhören die Möglichkeit Überleben zu sichern.
Aufhören hat viele Gesichter
Es gibt so viele Begriffe für Enden: Ziel, Erledigung, Vorgangsabschluss, Pensum-Erfüllung, Bilanzerstellung, Mittel-Versiegung, Ressourcenverbrauch, Verzehr, Verknappung, Stillstand, Fristablauf, Grenzerreichung, Verwirklichung, Krise, Zeugnis, Examen, Ruhestand, Entscheidung, Umschlag, Abschied, Trennung, Entzweiung, Revolution, Umsturz, Befreiung, Apokalypse, Katastrophe, Ruin, Bankrott, Untergang, Zerfall, Erosion, Tod.
Harald Welzer schreibt in seinem neuen Buch „Nachruf auf mich selbst“ davon, dass vielen dieser Beschreibungen etwas Schicksalhaftes anhaftet. Er sagt, wir haben als moderne Gesellschaft das Leben säkularisiert. Wir leben (fast alle) nicht mehr für das, was danach kommt. Wir erklären uns das Leben seit der Aufklärung eher mit rationalen und weltlichen Bezügen (Verantwortungen, Bedürfnissen, Emotionen etc.) und weniger mit „Gott hat es so gewollt“. Doch wenn etwas zu Ende geht, wenn wir mit etwas aktiv aufhören sollten, überlassen wir das als Gesellschaft lieber dem Zufall, dem Schicksal, dem „das sollte wohl so sein, hat sich so ergeben“. Der Tod (egal von was) ist leichter zu ertragen, wenn er un-säkularisiert bleibt, ein bisschen mystisch. Er ist leichter zu ertragen, wenn er nicht in unserer eigenen Verantwortung liegt. Wenn wir nichts dafürkönnen, müssen wir auch nichts gestalten. Es geschieht uns. Pech/Glück gehabt.
Harald Welzer begründet das damit, dass der bedingungslose Fortschrittsglaube der Moderne kein Ende kennt. Fortschritt sei eine kontinuierliche Ausweitung von Weltweitreiche (Hartmut Rosa). Rückschritte, Enden, Abschiede passen nicht in diese Vorstellung. Beenden wir etwas, fühlt es sich oft an, als würden wir die damit verbundenen Wertvorstellungen auch beerdigen. Da wir in der Moderne gelernt haben, dass wir Menschen schlau und groß und wunderbar sind und es bergauf zu gehen hat, fühlt sich ein Ende also schnell falsch an. Denn wir würden wohlmöglich im Innehalten bemerken, dass unser Weg auch Scheitern, Stolpern, Nichtwissen beinhaltete. Es wäre mit Schmerz oder Scham verbunden. Ein Ende besprechbar zu machen ist deswegen oft nicht Teil unserer alltäglichen Praxis.
Wir täten gut daran, neben dem Fortschritt auch die Regression oder die Annullierung des Fortschritts als gestaltbar anzuerkennen. Damit zu rechnen, dass es schief geht, dass etwas misslingen wird, wäre sehr gesund für uns. In Organisationen, im Privaten, in der Weltgemeinschaft.
Bisher nutzen wir vor allem eine Lösung: Eintrittswahrscheinlichkeiten berechnen, die Ver-Zahlung von Schicksalen. So ist Endlichkeit ausreichend entmenschlicht, wird vermeintlich kalkulier- und bearbeitbar. Alles andere, das Unerwartbare, muss die Ausnahme bleiben, sonst kann es nicht als Krise, und damit als „nicht menschengemacht, sondern Schicksal“, gerahmt werden. Wir müssten sonst Verantwortung übernehmen. Dann doch lieber Zufall – oder das Böse, die anderen. Krise erscheint uns handhabbarer.
Gegenteil von Fortschritt ≠ Krise
Eine Krise würde bedeuten, etwas wäre „Nicht-zu-erwarten-gewesen“, „Überraschend“, oder etwas sei ein Höhepunkt einer vorübergehenden problematischen Entwicklung (was gleichzeitig suggeriert, ab jetzt wird es wieder besser). Doch das Gegenteil von Fortschritt ist genauso normal wie der Fortschritt. In einer komplexen Welt geschehen Dinge, die zuverlässig dafür sorgen, dass nichts wieder an seinen Anfang zurückkehrt. Es gibt kein Es-wird-wieder-wie-früher. Das Gegenteil von Fortschritt ist auch Fortschritt: es ist ein sehr normales Endlichkeitsphänomen. Irgendetwas geht immer zu Ende.
Und so ist Aufhören können eine Bedingung für Neubeginn und beginnen zu können ist eine Bedingung dafür, aufhören zu können. Wer sich, der Organisation, der Gesellschaft nicht zutraut oder zugesteht, beginnen zu können, entwickelt Strategien, um nicht aufhören zu müssen.
Strategien, um nicht aufhören zu müssen
Funktionale Differenzierung
Wir schaffen Zuständigkeiten. In Organisationen werden Zuständigkeiten so kleinteilig organisieren, dass niemand sich für das große Ganze verantwortlich fühlen muss. Wir trennen Entscheidungskompetenzen und Expertise. Und auch im Privaten kriegen wir das hin. Ein Beispiel: Ich ernähre mich unterwegs, deswegen kann ich nicht entscheiden, dass ich nur regional Produziertes esse.
Ziele setzen statt Handlungen beenden
Wer Ziele definiert und sie nicht operationalisiert, kann sich tätig fühlen ohne Verantwortung übernehmen zu müssen. Ziele liegen in der Zukunft. Sie beruhigen das System. Ein aktuelles Beispiel: das 1,5 Grad-Ziel.
Die Entscheidung, keine Entscheidungen zu treffen
Wir sind so pluralistisch, wir halten mal alle Bälle in der Luft, verstehen alle Lager. Wir versuchen es lieber mit `False-Balance´ als uns dem Vorwurf auszusetzen, irgendjemandem keine Stimme gegeben zu haben. Nicht-Aufhören bedeutet hier: lass uns nochmal mit allen über alles reden, das ist Beteiligung, und Beteiligung ist ja per se etwas Gutes. Die Politik während der Corona-Pandemie ist ein schmerzhaftes Beispiel hierfür.
Eigentlich
Wir sammeln Wissen. Und glauben uns, das es noch mehr Wissen braucht. Das tun wir, obwohl wir wissen, dass Einsicht nur in seltenen Fällen zu neuem Handeln führt. Harald Welzer begründet dies damit, dass unsere moralischen Überzeugungen nicht handlungsleitend sind, sondern uns ja nur eine Richtschnur dafür geben, welche Begründung dafür geeignet ist, eine falsche Handlung mit einem richtigen Bewusstsein in Deckung zu bringen. Dafür haben wir das Scharnierwort „eigentlich“ in unseren Sprachgebrauch integriert. Eigentlich markiert den alltäglichen Widerspruch zwischen Anspruch und Handlung. So lässt es sich leichter mit inneren Widersprüchen leben. Gründe gibt es immer und sie kosten nichts. Noch nicht genug zu wissen ist eine gesellschaftlich akzeptierte Ausrede.
Ritualmangel
Die Kirche ist keine Ordnungsmacht mehr, ihre gesellschaftliche Funktion ist stark reduziert, aber sie hat oft noch ein Ritualmonopol. Wer nicht an Kirche angebunden ist, lernt weniger Rituale. Viele von uns kennen die wohltuende & heilende Wirkung des gemeinschaftlichen Feierns oder Klagens und des „jede*r weiß verlässlich, was er/sie bekommt, wenn X eintritt“ nicht mehr. Es fehlt uns an Ritual-Kompetenz. Und da wir keine passenden Rituale kennen, wäre die Gestaltung eines jeden Endes ein individueller Kraftaufwand. Einfach weitermachen erscheint uns dann ökonomischer.
Aufhör-Kompetenzen
Aus diesen Vermeidungsstrategien können wir Kompetenzen ableiten, wie uns Aufhören leichter gelingen kann. Drei davon hier zur Inspiration:
Rituale geben Abschieden eine Form
Wenn die Form für den Abschied von etwas fehlt, das einmal bedeutsam war, dann halten wir besonders intensiv am Alten fest. Verlustaversionen führen nicht zu Veränderungen. Es fühlt sich an wie eine Entwertung oder Annullierung von Arbeitskraft, Qualifikation, Identität. Deswegen braucht es Übergangsriten.
Ängste und Trauer brauchen das Kollektiv. Jammern braucht Zeit und Raum, um sich in Klagen verwandeln zu können. Trauern ist Arbeit. Rituale unterstützen das Einordnen von Erinnerungen, das Verzeihen, das Wiedererstarken von Kontakt und Ressourcen.
Oft wird davon gesprochen, dass wir doch bitte Loslassen lernen sollen: Wir mögen uns doch bitte dem Neuen zuwenden, dem Alten nicht länger hinterherweinen. Ja, stimmt oft. Hüpft aber zu kurz. Davor braucht es noch etwas, das wir Aufhörarbeit nennen können: Dem Bisherigen einen angemessenen Platz gewähren. Der Platz kann in der Erinnerung, im eigenen Körper, im Storytelling der Organisation liegen.
Und ein Ende braucht ein Fest zur Würdigung des Bisherigen, zum Feiern des Erreichten, zur Wahrnehmung der Leistungen und zum Spüren der Gemeinsamkeiten.
Gegenwärtig werden
Aufhören ist der bewusste Jetzt-Moment. Der einzige Augenblick, in dem Wandel entstehen kann. Die Zeit der Veränderung ist die Gegenwart. Nicht die Vergangenheit, nicht die Zukunft. Und der Raum der Veränderung liegt innerhalb, nicht außerhalb unserer Grenzen. Deswegen brauchen Aufhör-Prozesse einen Milton-Erickson-Moment: Du hast jetzt hier alle Zeit der Welt!
Wir halten inne und bemerken, was zu ent-scheiden ist.
Was irritiert? Was ist relevant? Was ist hier zu lernen?
Solche Momente brauchen Vertrauen und Bezogenheit. Dieses Vertrauen in der Gegenwart fußt auf Versprechen, dass zumindest irgendetwas in der Zukunft noch so verlässlich und stabil sein wird wie in der Vergangenheit. Welche inneren Sicherheiten tragen uns, wenn das außen gerade nicht sicher ist?
Wertedissonanzen ins Bewusstsein holen
Aufhören gelingt leichter, wenn ein Danach gedacht und gespürt werden kann. Es braucht also ein Hin-Zu, das wirkmächtiger ist als die Wirklichkeiten des Bisherigen in all ihren Facetten von (Des-)Interessen, Macht, Gewohnheiten …
Unsere moderne Gesellschaft hat uns gelehrt, dass wir kontextabhängig verschiedene Rollen einnehmen. In unseren Rollen gelten teils widersprüchliche handlungsleitende Werte. Wir distanzieren uns in manchen Rollen von Werten, die wir an anderer Stelle einfordern. Niemand hat mehr durchgehend die gleichen Werte und behandelt situationsunabhängig wechselnde Anforderungen mit der gleichen Antwort.
Aufhören verlangt von uns, diese Paradoxien zu bemerken, zu benennen, und dann unsere Interessen, moralische Überzeugungen und unser aktives Rollenrepertoire so weit in Einklang zu bringen, dass Handlung entstehen kann. Das ist großes Kino. Kein Wunder, dass es so selten gelingt.
Reflexionsfragen
Konstruktives Aufhören braucht also Ritualisierung, Gegenwärtigkeit und Ausrichtung. Was liegt näher, als zur Reflexion unsere Lieblingsfragen im Futur II zu beantworten:
– Angenommen, ich habe für mich und diese endliche Welt ausreichend aufgehört, wie werde ich ab jetzt gelebt haben?
– Was will ich dann ab jetzt mit meinem Leben (nicht) gemacht haben?
– Welche Wege will ich (nicht) gegangen sein?
– Wie will ich mit meinen biographischen Wunden umgegangen sein, so dass ich ihnen ausreichend Chance auf Heilung gab?
… und dann, ganz langsam, in die Antworten hineinleben.